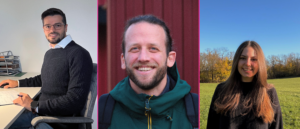Wir leben in einer digital vernetzten Welt, in der soziale Interaktion längst nicht mehr ausschließlich analog stattfindet, sondern auch – oftmals sogar im Schwerpunkt – auf diversen Social-Media-Plattformen und in Messengern. Das Angebot an Austausch, Unterhaltung und Selbstdarstellung erscheint schier grenzenlos und dies räumlich und zeitlich gesehen. Vernetzung über Länder- und Sprachgrenzen hinweg sind problemlos möglich, Informationen und Wissen kann jederzeit und überall abgerufen werden.
Ist also die digitale Welt ein Weg aus der Isolation? Bedeutet sie Schluss mit Einsamkeit?
Aus fachlicher Sicht spricht leider einiges gegen diese Annahme. Im Gegenteil, eine hohe Nutzung von Social-Media kann Einsamkeit fördern und durch diese Einsamkeit erhöht sich das potenzielle Risiko für delinquentes Verhalten. Der Verein NEUSTART betreut u.a. Jugendliche und Junge Erwachsene, die straffällig geworden sind. Im Rahmen der Delikt- und Beziehungsarbeit zeigt sich, dass viele von ihnen mit Einsamkeit und sozialer Isolation zu kämpfen hatten und haben. Ebenso spielt die Flucht in die digitale Welt eine Rolle, wo sie aufgrund ihrer Vulnerabilität für Straftaten im „Tausch“ für Gruppenzugehörigkeit leicht ansprechbar sind. Doch warum ist dem so?
Einsamkeit im digitalen Zeitalter
Studien belegen, dass hohe Nutzungszeiten im Internet und vor allem umfangreiche Social-Media-Interaktionen mit erhöhten Werten in Einsamkeitsskalen einhergehen – man ist sprichwörtlich eher gemeinsam einsam.
Einsamkeit ist die subjektive Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlichen sozialen Beziehungen (Prof.in Dr.in Maike Luhmann, 2022), d.h. Qualität geht vor Quantität. Die sozialen Interaktionen können zwar zahlreich vorhanden sein, nur stellt sich das Gemeinschaftsgefühl nicht ein, wenn der Austausch oberflächlich bleibt. „Likes“ und kurze Kommentare vermitteln eben oft kein tieferes Zugehörigkeitsgefühl, die Reichweite ersetzt nicht die Vertrautheit. Dazu kommt der Druck, nichts verpassen zu wollen und damit ständig erreichbar zu sein – was ermüdet und stattdessen das Bedürfnis nach Rückzug fördern kann.
Und letztlich verstärkt der gestiegene Vergleichsdruck (allein dieser Punkt wäre einen weiteren Beitrag wert) das Gefühl, eigentlich nicht dazu zu gehören. Denn das laufende Betrachten von idealisierten (überarbeiteten) Darstellungen von Gleichaltrigen unterminiert das eigene Selbstwertgefühl, was die gefühlte Isolation verstärkt
Delinquenz und Einsamkeit
Was hat dies nun mit straffälligen Verhalten zu tun? Einsamkeit allein ist natürlich nicht zwangsläufig ein kriminogener Faktor, doch kann sie Risikofaktoren fördern, die zu Delinquenz führen können.
Die schon erwähnte Suche nach Anerkennung spielt hier eine große Rolle. Gerade Jugendliche inmitten ihrer Entwicklung sehnen sich nach Gruppenzugehörigkeit und Anerkennung – und je einsamer man sich fühlt, desto leichter ist man hier ansprechbar. Gerät man in Kontakt mit Peer-Groups, die einem diese Anerkennung im Austausch für regelverletzendes Verhalten oder Mitgliedschaft und Beteiligung bei radikalisierten oder extremistischen Haltungen anbieten, ist das Risiko für radikalisiertes oder delinquentes Verhalten stark erhöht. Viele extremistische Gruppierungen setzen gezielt Instrumente wie „Real-Life XP Missions“ oder „Recruitment Quests“ mit strafbaren Aufträgen ein, die schrittweise in delinquentes Verhalten führen und Bindung sowie Abhängigkeit zu neuen Gruppen stärken.
Eine beeinträchtigte Impulskontrolle und Affektregulation können ebenfalls auftreten. Einsamkeit kann zu depressiven Verstimmungen und Wut-/Ohnmachtsgefühlen führen, weiters zu Stressreaktionen im Gehirn. Impulsives Verhalten, das gegen Normen und Gesetze verstößt, wird dadurch wahrscheinlicher – beispielsweise Gewalt oder Vandalismus – auch um gefühlte innere Spannungen abzubauen. In der Praxis berichteten einige Klient:innen, dass sie nach Phasen intensiver Nutzung von Social-Media das Gefühl hatten, zu verschwinden und nicht gesehen zu werden. Sie schilderten beispielsweise Gewalt gegen andere als Mittel, wieder zu spüren, dass sie nicht allein sind und auch gesehen werden.
Was tun? – Präventionsansätze
Social-Media – sowie das Internet an sich – sind gekommen, um zu bleiben. Daher sind alleinige Verbote nicht zielführend, ja kontraproduktiv, und führen eher zu einer Problemverschiebung. Jedoch können Verbote genutzt werden, um Räume zu schaffen, wo Prävention verstärkt wirken kann – denn diese sollte den Schwerpunkt für einen Umgang mit der digitalen Welt darstellen.
So kann beispielsweise in den Schulen oder in der Jugendarbeit ein verstärktes Augenmerk auf die medienpädagogische Aufklärung gesetzt werden, mit dem Ziel der Stärkung der Medienkompetenz, des gestärkten Bewusstseins für Filterblasen und des Abbaus von Vergleichsdruck.
Eine weitere wichtige Rolle im sensiblen Umgang spielen die Eltern. So hat mich zuletzt ein befreundeter Vater gefragt, was er tun könne, um seinem Sohn bei Social-Media zu begleiten und zu unterstützen. Zum einen hat er den wichtigsten Schritt schon gemacht, da er sich überhaupt damit beschäftigt. Zum anderen sind die Festlegung von medienfreier Zeit und eine offene Gesprächskultur wichtig. Jugendliche und Junge Erwachsene wollen in der Regel darüber reden, was sie in ihrem Alltag wahrnehmen – allein um es einordnen und reflektieren zu können. Dem Gefühl der Isolation und Einsamkeit kann hierdurch entgegengewirkt werden. Nicht zu vergessen ist auch der Vorbildcharakter von Erwachsenen. Wenn Jugendliche mitbekommen, dass die eigenen Eltern viele Stunden ihres Tages nur Social-Media nutzen und auch nicht darüber reden – warum sollten sie es dann tun?
Weiters können psychosoziale Angebote einsamen Jugendlichen Unterstützung bieten, bevor sich Gefühle von Isolation zu Risikoverhalten entwickeln. Hier stellt die Digitalisierung sicher eine besondere Herausforderung für Helfer:innen dar – denn idealerweise erfolgt die Ansprache und Sensibilisierung genau dort, wo sie auch entsteht: im Netz. Ich beobachte hier noch viele Berührungsängste und Vorbehalte, aber ich kann nur betonen: Wir können nicht nur im analogen Bereich tätig sein und Hilfe anbieten, vor allem wenn wir Jugendliche besser erreichen und sie aus der Einsamkeit holen wollen.
Fazit
Das geschilderte Spannungsfeld zeigt, wie eng digitale Lebenswelten mit realen sozialen und rechtlichen Konsequenzen verknüpft sind. Die Einsamkeit durch intensive Social-Media Nutzung fungiert dabei als kritischer Faktor: Sie verstärkt das Bedürfnis nach Anerkennung, kann die Impulskontrolle schwächen und ein Abgleiten in problematische Peer-Groups fördern.
Präventionsstrategien sollten daher auf die Reduktion der Einsamkeit vor allem durch den Aus- und Aufbau von stabilen analogen und digitalen Netzwerken abzielen. Dafür bedarf es eines Zusammenspiels von pädagogischer Medienbildung, psychosozialer Unterstützung und der Förderung positiver Gemeinschaftserfahrungen. So kann sich die digitale Alltagswelt zu einem Raum entwickeln, in dem Kinder und Jugendliche sich sozial eingebunden und sicher fühlen – und damit Delinquenz ein unwahrscheinlicheres Mittel ist, um Einsamkeit zu überwinden.
Dieser Artikel erschien am 6.7.2025 auf umbruchstelle.at.