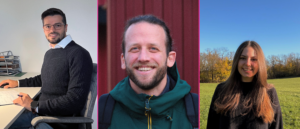Laut und zahlreich waren die Medienberichte, als das Innenministerium Mitte April die polizeiliche Anzeigenstatistik präsentierte. Je nach Blattlinie und Stil war von einem starken Anstieg bis hin zu einer nie dagewesenen Explosion der Jugendkriminalität zu lesen. Dass einige wenige Jugendliche für einen Gutteil der Anzeigen verantwortlich sind, blieb in der öffentlichen Darstellung weitgehend eine Randnotiz – abgesehen von der wichtigen Quellenkritik einiger weniger Medien.
Falscher Eindruck
Im Juni hat die Statistik Austria die Verurteilungszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahr wurden zwar mehr Jugendliche verurteilt, überblickt man aber einen Zeitraum von zehn Jahren, dann zeigt die Kurve in eine andere Richtung – nämlich nach unten. 2015 wurden 1806 Personen unter 18 Jahre verurteilt und 2024 waren es 1543. Das ist ein Rückgang um fast 15 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen ist der Rückgang mit 36 Prozent noch viel deutlicher.
Hand aufs Herz: Hätten Sie darauf gewettet, dass die Jugendkriminalität in den vergangenen zehn Jahren signifikant gesunken ist? Das ist sie nämlich, denn in einem Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung nicht nur für Erwachsene, sondern für alle, auch für Jugendliche. Nicht die Anzeigen, sondern die Verurteilungen sind die harte Währung, an der auch die Kriminalität gemessen werden sollte.
Die Aussage, dass die Jugendkriminalität explodiert, ist schlicht falsch. Dass dieser Eindruck vermittelt wird, ist in mehrerlei Hinsicht problematisch.
1. Aus rechtsstaatlicher Sicht: Auch für Jugendliche gilt die Unschuldsvermutung. Dass es viele Tatverdächtige gibt, bedeutet zunächst ja nur, dass es viele Anzeigen gibt – das kann an Schwerpunktaktionen der Exekutive liegen, an einer gestiegenen Anzeigebereitschaft oder schlicht an der Tatsache, dass Taten einiger weniger junger Menschen sehr oft zu Anzeigen geführt haben.
2. Aus Fairness gegenüber der jungen Generation: Wenn ständig das Bild gezeichnet wird, die Jugend würde immer krimineller, dann tun wir unserer Jugend unrecht. Das war schon immer so. Bereits auf einer antiken babylonischen Tontafel stand, die Jugend sei „böse, gottlos und faul“. In den 1950er-Jahren fürchtete man sich vor den „Halbstarken“, jetzt sind es einzelne Gruppen, die ganze Stadtviertel unsicher machen würden. Nur: Dass es Tradition hat, die Jugend zu verdammen, macht es nicht besser.
3. Aus gesellschaftlicher Perspektive: Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Im Umgang mit ihnen vergessen wir das häufig. Stattdessen zeichnen wir ein negatives Bild über die immer krimineller und rechtloser agierende Jugend. „Glaub an dich!“ muss unsere Botschaft an Jugendliche auch dann sein, wenn es um Schwierigkeiten, Zukunftsangst oder Einsamkeit geht. Gerade hier braucht es die Unterstützung der erwachsenen Gesellschaft und keine Dämonisierung.
4. Aus Sicht der Problemlösung: Es gibt einige wenige Jugendliche, die große Probleme haben und große Probleme machen. Für diese Jugendlichen braucht es gezielte, maßgeschneiderte Angebote, die als Ultima Ratio auch Anwesenheitspflichten in sozialpädagogischen Einrichtungen beinhalten können. Diese Arbeit ist enorm anstrengend und mit großen Herausforderungen verbunden, weil die Schicksale in der Kindheit häufig von psychischer Erkrankung, Gewalt, Alkohol- und Drogenabhängigkeit der Eltern geprägt sind. So schwierig die Arbeit mit diesen Jugendlichen ist, so lohnend ist sie gleichzeitig, weil junge Menschen im Vergleich zu Erwachsenen ein viel größeres Veränderungs- und Entwicklungspotenzial haben. Selbst bei sehr prekären Ausgangssituationen.
"Die aufgeheizte Stimmung ist kontraproduktiv."
Die Gesellschaft hat ein Recht auf ein Leben in Sicherheit. Kinder und Jugendliche sind in die Verantwortung zu nehmen, um Fremdgefährdung zu verhindern. Gleichzeitig sind sie vor Selbstgefährdung zu schützen. Kinder, die Straftaten begehen, müssen sowohl in die Pflicht genommen als auch dabei unterstützt werden, ein Leben ohne Kriminalität zu führen. Jede Prävention ist besser und kostengünstiger als Reaktionen auf Straftaten.
Ganz unabhängig von dem wahren Ausmaß der Jugendkriminalität muss es wirksame Reaktionen darauf geben und eine lösungsorientierte Zusammenarbeit von Politik, Sozialarbeit, Exekutive und Justiz. Gerade da tut sich sehr viel. Vor kurzem wurde für Wien ein Fünf-Punkte-Plan präsentiert, der in einer von der Landespolizeidirektion Wien und vom Bundeskriminalamt initiierten Arbeitsgruppe ausgearbeitet wurde. Im Bundesministerium für Justiz wird von einer Fachgruppe ebenfalls intensiv am rechtlichen Rahmen für sozialpädagogische Einrichtungen in Bezug auf Anwesenheitspflichten gearbeitet.
Einfacher wäre das Finden von Lösungen, wenn es auf Basis gut vergleichbarer Zahlen, Daten und Fakten passieren könnte. Die aufgeheizte Stimmung ist kontraproduktiv. Mein Wunsch wäre, dass die Anzahl der Anzeigen und jene der Verurteilungen gemeinsam in einem von der Statistik Austria verantworteten Bericht veröffentlicht werden. Dann haben Medien und Fachexpertinnen und -experten einen umfassenden Problemaufriss und die Basis, um sich an die Arbeit machen.
Dieser Gastkommentar von NEUSTART Geschäftsführer Christoph Koss erschien am 8.7.2025 auf DerStandard.at.